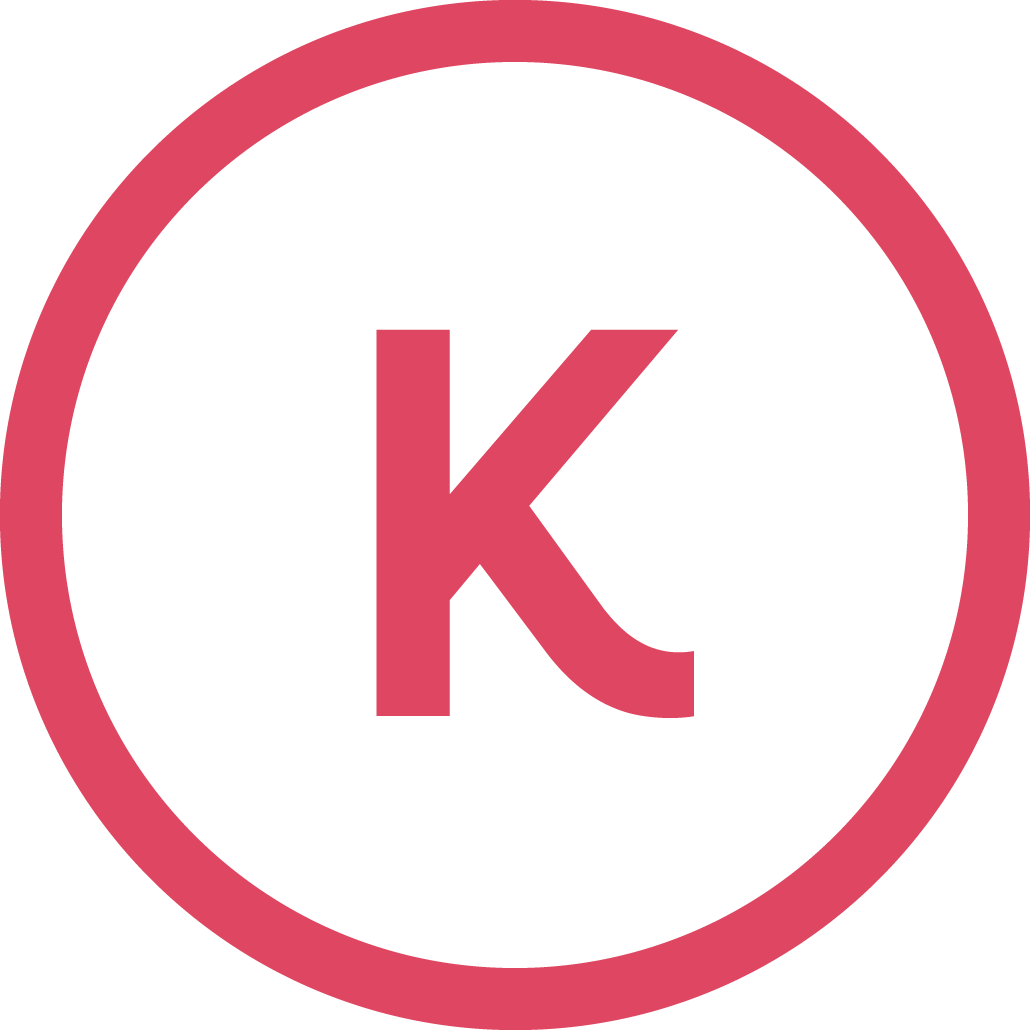Das Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen hat kürzlich einen Gesetzentwurf für eine Baugesetzbuch-Änderung vorgelegt. Dieser soll endlich den Wohnungsbau und die Schaffung von Wohnraum beschleunigen und erleichtern. Wesentliche Regelungen werden kurz betrachtet, Handlungsspielräume aufgezeigt und wichtige nächste Schritte aufgezeigt. Wir werden uns zudem in den nächsten Wochen mit allen Neuregelungen detaillierter auseinandersetzen.
1. Wesentliche Regelungen der BauGB-Novelle
Wesentlich für den Wohnungsbau sind die geplanten Regelungen des § 31 Absatz 3 BauGB, § 34 Absatz 3 a) BauGB, § 36 a) BauGB und § 246 e) BauGB.
1.1 § 31 Absatz 3 BauGB: Befreiung von Festsetzungen des Bebauungsplans zugunsten des Wohnungsbaus
Die geplante Neuregelung des § 31 Absatz 3 BauGB ermöglicht nun auch über den Einzelfall hinaus eine Befreiungserteilung von Festsetzungen eines Bebauungsplanes zugunsten des Wohnungsbaus. Der Gesetzgeber möchte bewusst die Aufstockung und Erweiterung von bestehenden Wohngebäuden sowie Hinterlandbebauungen ermöglichen. Der Begriff des „Wohnungsbaus“ ist weit zu verstehen. Neben dem Neubau soll die Erweiterung, Änderung und Nutzungsänderung von bestehenden Gebäuden erfasst sein. Damit bestünde die lange erhoffte Möglichkeit, Gewerbe- und Bürogebäude in Wohnraum umzunutzen. Gerade das Bauplanungsrecht hatte dies bisher oft blockiert.
Grenze der Befreiungsregelung:
Die Zustimmung der betroffenen Gemeinde ist erforderlich und die Befreiung muss mit öffentlichen Belangen vereinbar sein. Die Vereinbarkeit mit öffentlichen Belangen liegt nur vor, wenn die Befreiung unter Berücksichtigung der Kriterien der Anlage 2 zum BauGB voraussichtlich keine zusätzlichen erheblichen Umweltauswirkungen hat. Damit wird eine Umgehung europäischen Umweltrechts verhindert und die Europarechtskonformität hergestellt. Denn durch die Befreiungserteilung kann die Änderung eines Bebauungsplanes entbehrlich gemacht werden, die ihrerseits ggf. eine Umweltprüfung erfordern könnte. Öffentliche Belange dürften jedenfalls gewahrt sein im Falle der Errichtung von weniger als 20.000 m² zulässiger Grundfläche (§ 19 Absatz 2 BauNVO). In diesem Falle wäre ein beschleunigtes Bebauungsplanverfahren nach § 13a BauGB ohne Durchführung einer Umweltprüfung zulässig.
1.2 § 34 Absatz 3 a) BauGB: Erweitertes Baurecht im Innenbereich ohne Bebauungsplan zugunsten des Wohnungsbaus
Die Neuregelung ermöglicht Baugenehmigungen für Grundstücke, in denen kein Bebauungsplan existiert, die sich aber in einem Bebauungszusammenhang befinden. Bisher mussten sich Bauvorhaben in die „Eigenart der näheren Umgebung“ einfügen, d.h., sie mussten sich insb. nach Höhe, Baumasse, Grundfläche und Nutzungsart in die bestehende Bebauungsstruktur einfügen (von Ausnahmefällen abgesehen). Hier soll zugunsten des Wohnungsbaus bewusst eine Überschreitung bestehender Nutzungsmaße zugelassen werden. Ebenso soll eine Aufstockung von Nicht-Wohngebäuden durch Wohnungen (bspw. Supermärkte) zugelassen werden. Es werden Möglichkeiten geschaffen, mehr Baugenehmigungen ohne Aufstellung eines sonst erforderlichen Bebauungsplanes zu erteilen. Dies spart vor allem Zeit (Vorhabenträger/innen aber auch viel Geld).
Eine Grenze der Regelung stellt aber wiederum die Zustimmungspflicht der Gemeinde nach § 36 a) BauGB dar, um der verfassungsrechtlichen gemeindlichen Selbstverwaltungshoheit Rechnung zu tragen. Ebenso muss das nach § 34 Absatz 3 a) BauGB zulässige Bauvorhaben wiederum mit nachbarlichen Interessen und öffentlichen Belangen vereinbar sein.
1.3 § 36 a) BauGB: Zustimmungspflicht der Gemeinden im Falle des § 31 Absatz 3, § 34 Absatz 3 a) BauGB
Um den weitreichenden Möglichkeiten der Befreiungserteilung nach § 31 Absatz 3 BauGB und der Baugenehmigungserteilung nach § 34 Absatz 3 a) BauGB Rechnung zu tragen, muss die betroffene Gemeinde der Befreiung oder der Baugenehmigung zustimmen. § 36 a) Absatz 1 Satz 2 BauGB besagt, dass die Gemeinde die Zustimmung erteilt, wenn das Vorhaben mit ihren Vorstellungen von der städtebaulichen Entwicklung und Ordnung vereinbar ist. Hiermit wird sichergestellt, dass die kommunale Selbstverwaltungshoheit gewahrt und städtebauliche Entwicklungskonzepte und –pläne nicht umgangen werden können. Die Zustimmung kann unter der Bedingung erteilt werden, dass der Vorhabenträger(in)/Bauherr(in) sich verpflichtet, bestimmte städtebauliche Anforderungen einzuhalten. Die Gemeinden können nach Vorstellung des Gesetzgebers also an dieser Stelle mit den Bauherrn/der Bauherrin Vereinbarungen treffen, die sonst üblicherweise im Rahmen städtebaulicher Verträge geschlossen werden (Vorgaben zum sozialen Wohnungsbau bspw.). Damit wird – trotz Bindung an Gesetz und Recht – ein weiter Verhandlungsspielraum zugunsten der Gemeinden eröffnet. Es bleibt abzuwarten, ob die Regelung des § 36 a BauGB in Berlin auch auf die Bezirke Anwendung finden wird.
1.4 § 246 e) BauG: „Bauturbo“ und „Experimentierklausel“
Die weitreichendsten Abweichungsmöglichkeiten vom geltenden Bauplanungsrecht (insb. BauGB, BauNVO, bestehende Bebauungspläne) ermöglicht diese geplante Neuregelung, befristet bis zum 31.12.2030. Bauvorhaben sollen ohne Bebauungsplanverfahren in den nachfolgenden Fällen genehmigt werden können:
- Errichtung eines Wohngebäudes mit mind. 6 Wohnungen,
- Erweiterung, Änderung oder Erneuerung eines rechtmäßig errichteten Wohngebäudes, wenn neuer Wohnraum geschaffen oder Wohnraum wieder nutzbar gemacht wird,
- Nutzungsänderung eines rechtmäßig errichteten Gebäudes in ein Wohngebäude (einschließlich Änderung/Erneuerung).
Räumlich erfasst sind sowohl Gebiete, für die ein Bebauungsplan existiert, als auch Gebiete, für die kein Bebauungsplan existiert, die sich aber in einem Bebauungszusammenhang (§ 34 BauGB) befinden sowie Grundstücke im Außenbereich (§ 35 BauGB), die sich in der Nähe eines Siedlungsbereichs oder bebauten Gebiets (§ 30 Absatz 1, 2, § 34 BauGB) befinden (§ 246 e) Absatz 3 BauGB). Ein Abstand von maximal 100 m dürfte die Grenze bilden, um noch einen räumlichen Zusammenhang zu bestehenden Siedlungsbereichen annehmen zu können.
Zeitlich können Baugenehmigungsverfahren auf Basis des § 246 e) BauGB bis zum 31.12.2030 durchgeführt werden (§ 246 e) Absatz 4 BauGB).
Auch hier ist die Zustimmung der Gemeinde zur Erteilung von Baugenehmigungen erforderlich, § 246 e) Absatz 1 Satz 1 i.V.m. § 36 a) BauGB. Ferner bildet das Umweltrecht eine Grenze: Die Baugenehmigung darf nur erteilt werden, wenn die Abweichung von geltendem Bauplanungsrecht (unter Würdigung nachbarlicher Interessen) mit öffentlichen Belangen vereinbar ist. Dies ist nur dann der Fall, wenn sie unter Berücksichtigung der Kriterien der Anlage 2 zum BauGB voraussichtlich zu keinen zusätzlichen erheblichen Umweltauswirkungen führt.
2. Fazit
Mit der BauGB-Novelle könnte ein großer Beitrag zur Beschleunigung des Wohnungsbaus geleistet werden. Insbesondere der Wegfall des Einzelfall-Bezugs in § 31 Abs.3 BauGB wäre sehr hilfreich, um mehrfach Aufstockungen und Nachverdichtungen zuzulassen. Auch oft ungenutzte Hinterlandgrundstücke könnten endlich leichter bebaut werden. Diese brachliegenden Flächen gilt es insbesondere in Großstädten zu nutzen. Vor allem im Westteil Berlins, für den der Baunutzungsplan, ein alter Bebauungsplan aus dem Jahre 1960 mit nicht mehr zeitgemäßen zu geringen Nutzungsmaßen gilt, bietet § 31 Absatz 3 BauGB mehr Flexibilität.
Ferner wäre eine weite Auslegung des „Gebots des Einfügens“ durch die Neuregelung des § 34 Absatz 3 a) BauGB eine große Hilfe in Gebieten mit geringen Nutzungsmaßen/Gebäudehöhen und Baumassen. Durch die gemeindliche Zustimmung wird ein Einfügen geplanter Vorhaben in die Umgebung sowohl hinsichtlich der Nutzungsarten, als auch der Bauvolumen kontrollierbar. Auch die Nutzungsänderung von Büro-/Gewerbegebäuden in Wohnnutzungen wird endlich ermöglicht.
Dennoch birgt das Zustimmungsinstrument des § 36 a) BauGB auch die Gefahr, dass Gemeinden je nach politischer Ausrichtung anfangen, mit den Vorhabenträgern/Bauherrn über Themen wie bspw. den sozialen Wohnungsbau oder die Grundstücksbegrünung in ungesundem Maße zu „feilschen“. Dies ist leider im Zusammenhang mit der Befreiungserteilung nach § 31 Absatz 2 BauGB bereits teilweise gelebte Praxis. Auch ist noch unklar, in welchem Umfang Gemeinden im Einzelfall die Einhaltung „bestimmter städtebaulicher Anforderungen“ von Bauherrn/innen verlangen können. Die Anforderungen im Falle des Verzichts auf einen Bebauungsplan sind andere als im Falle der Erteilung einer Befreiung nach § 31 Absatz 3 BauGB oder einer Baugenehmigung nach § 34 Absatz 3 a) BauGB.
Für eine sinnvolle Handhabung des § 246 e) BauGB gilt es seitens der Bauherrn/in zusammen mit den betroffenen Gemeinden zügig und gleich zu Beginn eines Planungsprozesses eine Umsetzungsstrategie zu erarbeiten. Soll auf ein Bebauungsplanverfahren verzichtet werden, müssen die betroffenen öffentlichen und privaten Belange im Einzelfall dennoch gewahrt bleiben. Wer künftig die notwendigen (fachgutachterlichen) Nachweise insb. für die Einhaltung der Vorgaben zum Umweltschutz, Immissionsschutz, Denkmalschutz und menschlicher Gesundheit erbringen muss, ist offen. Bauherrn wären gut beraten, im Vorfeld des Erwerbs eines potentiellen Baugrundstücks oder bei Prüfung von potentiellen Nachverdichtungsoptionen prüfen zu lassen, inwieweit die Neuregelungen des BauGB die Genehmigungsfähigkeit ermöglichen und welche Nachweise für die Baugenehmigung zu erbringen sind. Auch bei Nutzungsänderungen von Gewerbe in Wohnen wäre dies im Einzelfall zu prüfen. Hier spielen wiederum auch bauordnungsrechtliche Fragen eine Rolle. Risiken sollten frühzeitig ermittelt werden, um nicht dem Irrglauben zu verfallen, nun sei ein „Persilschein“ für jegliche Wohnbebauung erteilt.